
Die Zukunft der Arbeit: Führung virtueller Teams meistern
Von der technischen Ausstattung bis zur Beziehungsgestaltung – so gelingt die virtuelle Zusammenarbeit.
Die neuen Kommunikationstechnologien ermöglichen eine örtliche und zeitliche Flexibilisierung der Arbeit. Die virtuelle Zusammenarbeit ohne räumliche Einschränkungen hat den Vorteil, dass Kosten für Büroräume und Dienstreisen eingespart werden können. Die Mitarbeiter:innen gewinnen Zeitsouveränität und Verantwortung für die Gestaltung der eigenen Arbeit.
Diese neue Form des Zusammenarbeitens bringt aber auch neue Anforderungen mit sich, so dass Führungskonzepte angepasst werden müssen. Dabei lassen sich folgende Handlungsfelder unterscheiden:

1. Organisationaler Kontext
- Unternehmen müssen Rahmenbedingungen für die virtuelle Zusammenarbeit schaffen, in denen Mitarbeiter:innen effizient und gesund arbeiten können. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Bereitstellung der notwendigen technischen Ausstattung. Unternehmen sollten daher Budgets für Geräte wie Laptops und Monitore sowie für Softwarelizenzen für Kollaborationstools einplanen.
- Die Wahl der richtigen Technologie ist entscheidend für die virtuelle Zusammenarbeit. Daher sollte regelmäßig Feedback von den Mitarbeitenden eingeholt werden, um sicherzustellen, dass die Tools den spezifischen Anforderungen des Teams entsprechen.
- Die Gestaltung der Arbeitsplätze und Büros muss den unterschiedlichen Bedürfnissen der Mitarbeitenden Rechnung tragen. Zur Bürogestaltung gehören flexible Arbeitsplätze, multifunktionale Räume, Räume für Präsenz- und virtuelle Besprechungen sowie Rückzugsmöglichkeiten und ruhige Arbeitsplätze für konzentriertes Arbeiten. Auch Sozialräume wie Sitzecken, Kaffeeküchen oder Lounges dürfen nicht fehlen, um informelle Kommunikation und Pausen zu fördern.
- Wichtig ist auch die technische Unterstützung bei Problemen. Unternehmen sollten daher sicherstellen, dass die Mitarbeiter:innen bei Problemen schnell Hilfe erhalten.
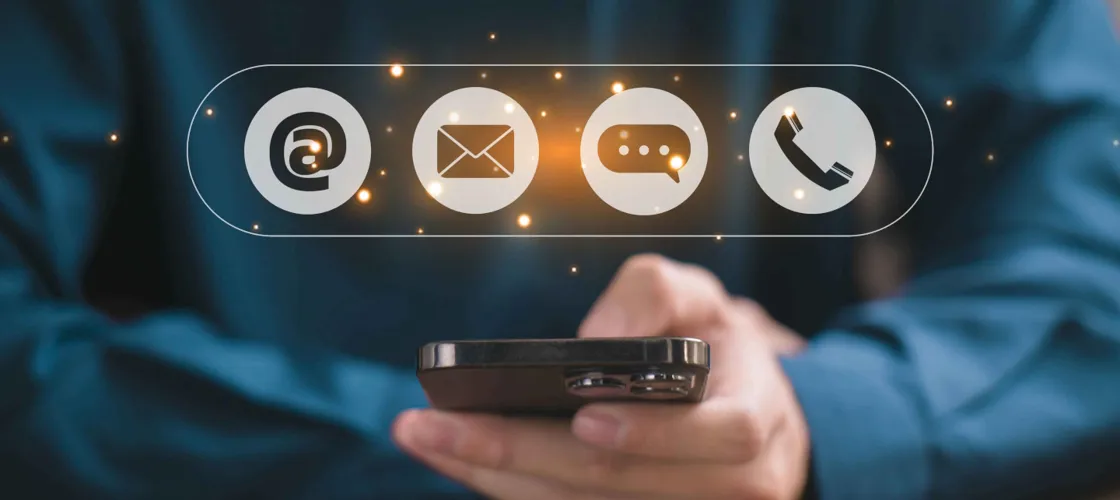
2. Herausforderungen auf der Handlungsebene
- Neben der Auswahl der geeigneten Technologie ist oft auch der zielgerichtete Einsatz eine große Herausforderung. Je nach Kommunikationsinhalt empfiehlt sich die Verwendung unterschiedlicher Kommunikationsmedien. Im Sinne des Media-Richness-Modells muss für jeden Kommunikationsinhalt der richtige Kanal gefunden werden. Aufgabe der Führungskräfte ist es, für die Medienwirkung der verschiedenen Instrumente zu sensibilisieren.
- Ausgehend von der Tatsache, dass je nach Kommunikationstool unterschiedlich viele Informationen über Gestik und Mimik vermittelt werden, stellt die Art und Weise der Interaktion mittels Technik eine weitere Herausforderung dar. Beispielsweise fallen diese Informationen bei der Kommunikation per E-Mail gänzlich weg. Daher ist es notwendig, dem schriftlichen Ausdruck mehr Aufmerksamkeit zu schenken, da die technikunterstützte Kommunikation ein erhöhtes Konfliktpotential mit sich bringt.
- Eine dritte Herausforderung ist die Zunahme der Kommunikation und die Organisation der Kommunikation. Denn in der virtuellen Zusammenarbeit geschieht Kommunikation nicht mehr nebenbei, sie muss vielmehr koordiniert werden. Bei der formalen Kommunikation über Ziele und Aufgaben funktioniert dies bei entsprechender Koordination nach wie vor gut. Die informelle Kommunikation nimmt jedoch ab, da ein zufälliges Treffen in der Kaffeeküche oder beim Mittagessen durch die virtuelle Zusammenarbeit erschwert wird und in der Folge zu Informationsverlusten führt. Obwohl sich die Führungskräfte der Bedeutung des informellen Austauschs bewusst sind, ergreifen sie selten konkrete Maßnahmen zu dessen Förderung.

3. Vereinbarungen im Team
Die Flexibilisierung der Arbeitszeit ermöglicht den Mitarbeitenden eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. So können sich Mitarbeitende nachmittags um die Kinderbetreuung kümmern und abends wieder ihren beruflichen Aufgaben nachgehen. Dies erschwert jedoch die Zusammenarbeit und sollte im Team abgesprochen werden. Führungskräfte haben dabei die wichtige Aufgabe, diese Vereinbarungen mit dem Team zu erarbeiten und auf deren Einhaltung zu achten.
- Festlegen von Kernzeiten für gemeinsames Arbeiten, in denen Mitarbeitende für Kollegen:Kolleginnen bzw. Kunden:Kundinnen erreichbar sein sollten
- Festlegen von Zeiten der Nicht-Erreichbarkeit
- Festlegen von Systemen, mittels derer die Erreichbarkeit außerhalb dieser Kernzeiten transparent gemacht werden kann – zum Beispiel durch Freischalten des Kalenders oder durch die Anzeige des Status in Kommunikationstools
- Festlegen von regelmäßigen Besprechungsterminen – auch in Präsenz

4. Veränderte Beziehungsgestaltung
Führungskräfte sind es gewohnt, ihre Mitarbeitenden bei der Arbeit zu sehen und haben so zumindest das Gefühl zu wissen, was ihre Mitarbeitenden leisten. Bei der virtuellen Zusammenarbeit funktioniert das nicht mehr. So entsteht bei manchen Führungskräften der Eindruck, dass die Mitarbeitenden zu Hause oder unterwegs nicht so viel arbeiten. Dieser Eindruck wird verstärkt, wenn die Mitarbeitenden im Home Office nicht erreichbar sind.
Gegenseitiges Vertrauen ist daher in der digitalen Zusammenarbeit umso wichtiger und sollte aktiv gefördert werden, zum Beispiel durch Vereinbarungen zur Erreichbarkeit. Eine Möglichkeit kann sein, dass sich Mitarbeitende oder Führungskräfte spätestens 30 Minuten nach einer Kontaktaufnahme zurückmelden.
Aber auch die sozialen Beziehungen zwischen den Teammitgliedern werden durch die virtuelle Zusammenarbeit nicht optimal gefördert. Denn viele soziale Prozesse, die im direkten Kontakt spontan entstehen, müssen in der virtuellen Zusammenarbeit explizit koordiniert werden. Dadurch sinkt häufig die soziale Unterstützung. Dies kann sich negativ auf die Beanspruchung auswirken, denn soziale Unterstützung ist eine zentrale Ressource in belastenden Situationen.
Deshalb ist es wichtig, dass die Teammitglieder die Möglichkeit haben, sich regelmäßig auszutauschen, und zwar nicht nur online, sondern auch persönlich.
Fazit
Die vier Handlungsfelder zeigen, dass die Führungskräfte in der Kommunikation mit den Mitarbeitenden weiterhin gefordert sind und das Ausmaß der Kommunikation durch die virtuelle Zusammenarbeit erhöht wird. Vieles, was im persönlichen Kontakt nebenbei entsteht, wie soziale Beziehungen und Vertrauen, muss in der virtuellen Zusammenarbeit aktiv angegangen und geplant werden. Dies bindet Ressourcen der Führungskräfte. Auf der betrieblichen Ebene ist daher auch immer wieder zu prüfen, ob die Führungssituation es zulässt, diese erhöhte Kommunikation mit den Mitarbeitenden zu ermöglichen. Denn nur wenn die Zusammenarbeit auch virtuell funktioniert, können die Mitarbeitenden leistungsfähig und gesund bleiben und die Vorteile der Flexibilisierung genutzt werden.
Weitere Infos
Alle Infos zur AUVA-Kampagne "Gemeinsam sicher digital" und zum Kampagnen-Schwerpunkt "New Work" finden Sie auf unserer Website:
Bei Fragen zum Thema steht Ihnen das AUVA-Präventionsteam gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter sichereswissen@auva.at















